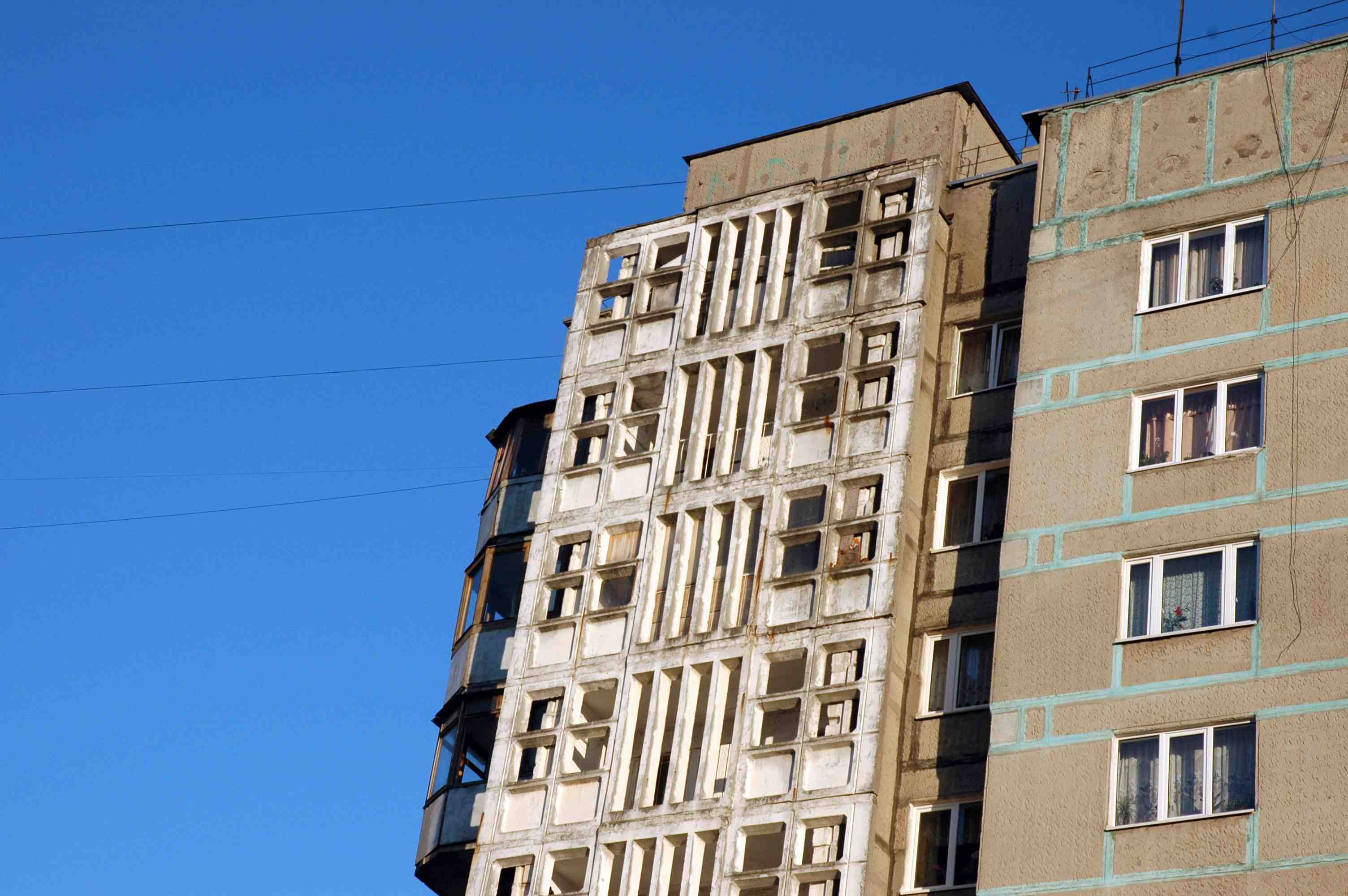„Wir haben die neuen Naturwissenschaften erlebt: unser Auge ist subtiler geworden, rechnerischer, es sieht mit der Erscheinung der Pflanze zugleich ihren inneren Bau. Die allgemeine Evolution der Technik ist über uns dahin gebraust, mit ihren Massenprodukten und ungewohnten Konstruktionen: unser Auge ist an starke Gegensätze gewöhnt, empfindet freisinniger, es fühlt das monotone Ein-bei-Ein der Bäume des Forstes so groß, wie es beglückt auf der abspannenden Unbegrenztheit des Meeres, der schönen Öde der Heide oder der farbigen Weite der Wüste ruht – wir sind neue Menschen!“
Leberecht Migge, Die Gartenkultur des 20. Jahrhunderts

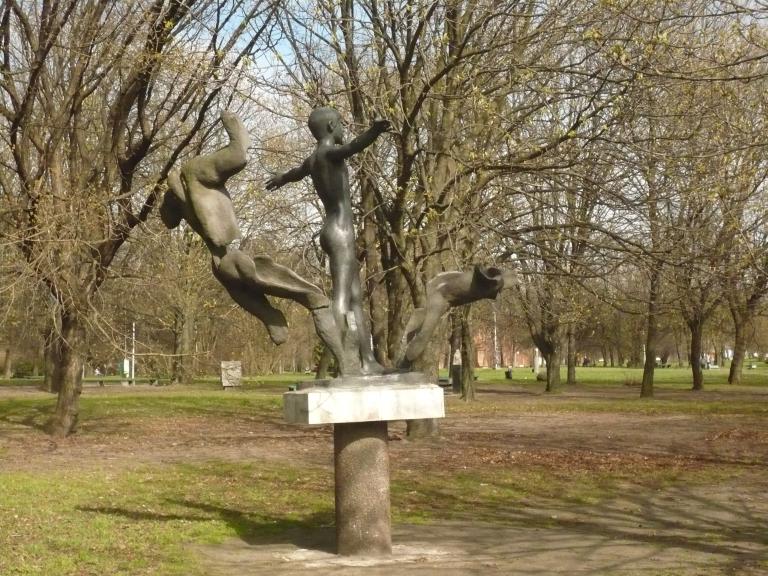
Man stößt in dieser Stadt ungewöhnlich oft auf Häufungen von Porträts. So hängen an unserer Hotelfassade Simon Dach, Kant, E.T.A. Hoffmann, Erlichshausen, Albrecht, Ottokar, Wilhelm, Friedrich und der Große Kurfürst. Immerhin mit Bildunterschrift versehen. In der Universität hat jede Abteilung ihre Porträts, die modernen von den Lehrenden, die älteren von den Klassikern, allerdings ohne Beitext. Bei den Anglisten, wurde uns erzählt, gehört zum Einstellungsverfahren der Test, die Porträts der englischsprachigen Schriftsteller fehlerfrei zuordnen zu können. Gewinnen sie also erst Bedeutung, wenn man weiß, wie sie heißen? Kommt hier nicht gleich wieder die Frage nach der Übereinstimmung von Name und Gegenstand auf?