Bevor mir Jörg alles wegfotografiert, hier nun mein eigener, spezifischer Blick mit der Kamera. Mein Augenmerk war auf allem Angeordneten, Rechteckigem. Die Stadt zum Quadrat, die Stadt in der Ordnung des Blicks.





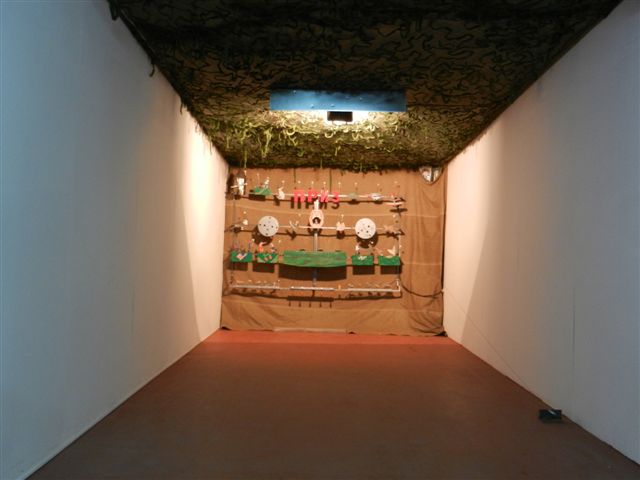






Bevor mir Jörg alles wegfotografiert, hier nun mein eigener, spezifischer Blick mit der Kamera. Mein Augenmerk war auf allem Angeordneten, Rechteckigem. Die Stadt zum Quadrat, die Stadt in der Ordnung des Blicks.





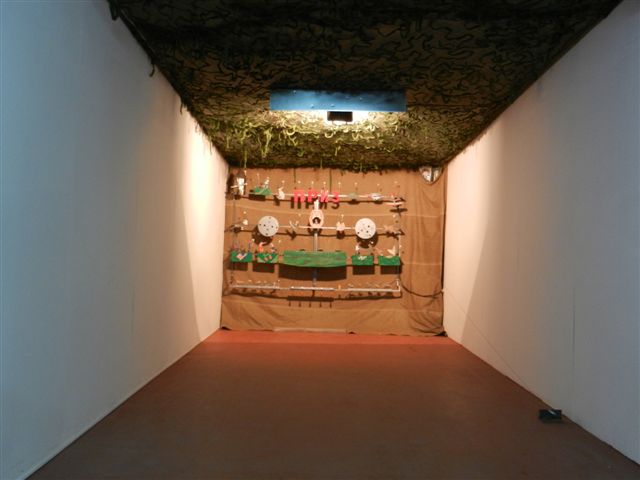






Also, weiter mit der Story: Die Nazis benannten das Haus der Technik 1935 um in Schlageter-Haus. Schlageter Schlageter, unterbricht Virginia mich, kaum habe ich angefangen, da ist er wieder: Albert Leo Schlageter, Aktivist im Kampf gegen die Franzosen während der Ruhrbesetzung, 1923 zum Tode verurteilt, unter anderem wegen Sprengstoffanschlägen. Und anschließend, ergänze ich, von rechtsextremen Gruppierungen zum Märtyrer stilisiert. Vergleiche, sagt Virginia, meine nie abgeschlossene Hausarbeit im Hauptseminar: Linker und rechter Terror im Ruhrgebiet in der Weimarer Zeit, Wintersemester, öhm, 2004/05, glaube ich, an der Ruhr-Universität Bochum, in der ich mich vor allem mit der sogenannten Schlageter-Kompanie beschäftigt habe oder beschäftigen wollte, einer als Wanderverein getarnten, verdeckt agierenden Untergrundeinheit, die Arbeitslose im Ruhrpott zum Eintritt in die Reichswehr bewegte. Im Namen des Geistes von Schlageter?, frage ich. Im Namen der Gänsefüßchen eisernen Disziplin Gänsefüßchen, sagt Virginia, und unter dem Banner des inzwischen wohlbekannten Hakenkreuzes.

Das Schlageter-Haus büßte übrigens im Laufe des Krieges sein Dach ein
und war daraufhin einfach offener Marktplatz. Aber was, was genau
motivierte wohl, weitab von Schlageters Einsatzorten Essen, Bottrop und
und Duisburg, die Nazis, ausgerechnet in Königsberg das Haus so zu
nennen?, frage ich Virginia. Die klickt sich nebenbei durch alte
Uni-Dateien und erzählt, aus dem Gedächtnis oder ablesend, das kann ich
nicht sehen: Die Distanz zum Ruhrgebiet ist dabei ziemlich egal.
Schlageter war ja Märtyrer und dadurch überall! Es gab Theaterstücke wie
Hanns Johsts Prototyp des nationalsozialistischen Dramas mit dem
einfach zu merkenden Titel: Schlageter, UND es gab die Antrittsrede
eines Philosophen mit H, natürlich nicht Hamann, Antrittsrede als Rektor
in Freiburg, in der dieser Philosoph Schlageters Hinrichtung als
Gänsefüßchen den schwersten und größten Tod harten Willens und klaren
Herzens Gänsefüßchen feierte, UND es gab für Schlageter bis zum Ende des
Krieges wohl an die hundert Denkmäler, teils schon in der Weimarer
Republik. Unter den Nazis hießen auch Luftgeschwader, Kasernen und
Brücken nach Schlageter. In Bottrop nennen manche Leute heute noch die
Stadtteiche Schlageterteich, wie auch hier einige noch am Telefon nicht
das Epizentr, sondern das Schlageter-Haus verlangen. Das Epizentrum
welcher historischen Beben ist das hier also?

Ein Hamannhaus gibt es dagegen gar nicht, sagt Virginia, oder doch?
Nein, wenn du googlest, kommst du zumindest nur auf die Hamann Haus GmbH
Hausbau in Berlin. Und was lernen wir daraus?, frage ich. Keenen Plan.
Daß es immer die Ideologie ist, die die Namen wählt, ob
Nationalsozialismus oder Neoliberalismus! Ist er nicht fantastisch, sagt
Virginia, und zeigt auf mich, ohne auf mich zu zeigen, aus allem macht
er einen moralischen Anschauungsunterricht. Tja, I hate being a role
model. Aber jetzt muß ich zum Mittagessen, wir sprechen!

Samstagabendkorrespondenz: Du bist doch jetzt der Experte,
schreibt mir Dario, du mußt mir weiterhelfen bei der Entwicklung dieses
Online-Tutorials: Wie lese ich Hamann? Zum Beispiel: Hat es eigentlich
einen tieferen Sinn, daß Hamann Metaphysick schreibt und Ästhetick? Ist
das reine Sache der Rechtschreibung [siehe: die Ausführungen Deiner
Kollegen Hendrik und Marion zu Orthographie]? Oder hat Metaphysick mit
Sickness zu tun und Ästhetick mit Ticks? Ich schreibe dir später,
antworte ich, erstens bin ich tatsächlich sick [Erkältung], und zweitens
beginnt gleich mit der Ostermesse die Ästhetick.
Beim Besuch des Gottesdienstes sollte dann das Metaphysische ins Zentrum
rücken. Doch kaum bei der Christ-Erlöserkirche angekommen, dem höchsten
Gebäude der Stadt, schieben sich die höheren Gründe des Seins erstmal
in den Hintergrund zugunsten diverser Inszenierungen.
Stufe Eins: der Vorplatz, abgeriegelt, Gitter, Sicherheitsdetektoren und
vor allem massive Polizeipräsenz. Die Uniformen der hiesigen
Polizisten, die im Vergleich zu der deutschen, eher nach Wachtmeister
aussehenden Polizeikleidung, wesentlich militärischer wirken, die hohen
Mützen, wie man sie von den Berliner Flohmärkten und
Ostalgiesouvenirständen zu kennen glaubt, der Schnitt von Jacken und
Hosen, alles versprüht – auch wenn das Militärische an sich nicht behagt
– wesentlich mehr Glamour als deutsche Polizeiuniformen. Und Glamour
macht Angst, auch hier.
Stufe Zwei: in der Kirche. Hier inszenieren sich die Bewohner der Stadt
als Gläubige. Die Frauen bedecken ihre Haare. Kerzen werden angezündet.
Junge Männer sind allein dort, um mit den anderen zu beten, und wenn sie
mit ihrer Freundin da sind, dann wegen ihrer Freundin, auf die sie
immer wieder schauen, während sie beten. Fotografen versuchen,
charismatische Gottesdienstbesucher abzulichten, die sich entweder
verweigern oder versuchen, besonders fromm auszusehen. Eine Frau
beschwert sich bei zwei Ausländern, weil die zu laut reden und sogar zu
laut lachen.
Stufe Drei: vorne. Das Zentrum der Blicke. Die Ikonostase. Im
Siebenjährigen Krieg gefertigt, über Stockholm und Hamburg Mitte der
Neunziger nach Kaliningrad gekommen. Von hier aus wirkt die große
Inszenierung, die den avancierteren Stadttheateraufführungen in
Deutschland ebensowenig nachsteht wie Performances freier Gruppen. Schon
als die Besucher der Messe hereinkommen, werden aus dem Off die
Evanglien gelesen. Eine gute Form von Einlaß: Du bringst das Publikum in
Stimmung, noch bevor es losgeht, eine Mischung aus Auflockern und
Anspannen, genau richtig. Währenddessen geht eine der drei Türen der
Ikonostase – golden, auf ihr ist ein Christusportrait appliziert – immer
wieder auf, und einer der Priesterdiener tritt heraus, schaut in die
Zuschauerschaft, als wolle er jemanden sichten oder nur schauen, ob nun
genügend Publikum anwesend ist, er schaut die Menschen an, STARRT sie
an, dann geht er ab, die Tür schließt sich. Kurz nach der angekündigten
Anfangszeit haben dann die Priester ihren Auftritt, noch nicht in den
prunkvollsten Gewändern allerdings, einige kommen aus der Ikonostase,
andere tauchen unter den Zuschauern auf, alle aber einzeln. Einzeln
treten sie an das Mikrophon, das mitten unter den Zuschauern steht, und
beginnen ihre Lesungen in Singsang. Das Sprechen in Mikrophone, auch das
ein beliebtes theatrales Mittel spätestens seit den neunziger Jahren in
der deutschsprachigen und angrenzenden Theater- und
Performancelandschaft. Genauso wie interaktive Elemente: Die Menschen
beginnen, kaum hat der erste Priester angefangen, sich zu bekreuzigen,
und sie hören gar nicht mehr auf, immer wieder und wieder. Die Bühne
bleibt indessen weiterhin unbevölkert, in ihrer ganzen Pracht, verweist
aber in dieser Herrlichkeit auf das, was dahinter vor sich gehen mag.
Wie könnte Transzendenz anschaulicher inszeniert werden als hier, wo
alle warten und warten und aus der betenden Zuschauerschaft heraus auf
die Bilder des Glaubens eingeredet wird? [Erst am nächsten Tag erzählt
Marion, daß sich, nachdem wir die Messe verlassen haben – zumindest in
der Fernsehfassung dieses Ereignisses –, die Ikonostase noch öffnete, um
die Priester in voller Gewandung zu zeigen.] Nach einer Stunde
Dauergebet und Dauerbekreuzigung ohne erkennbare Höhen und Tiefen ist
klar: Es ist eine Durational Performance, die hier abläuft.
Dramaturgische Spitzen werden absichtlich nicht gesetzt, es geht darum,
sich in der gleichbleibenden Bewegung von Worten, Händen und goldenen
Türen zu verlieren, in eine Art Trance zu kommen und darin über Dinge
nachzudenken, an die man sonst nicht herankommen würde. Von
zweiundzwanzig Uhr bis vier Uhr theatrales Dauerprogramm.
Auf dem Weg nach Hause – so schließe ich meine lange
Beschreibungsmail an Dario ab – muß ich an eine Inszenierung von vor
wenigen Jahren denken, und dreimal darfste raten, welche!? Das ist nicht
schwer, schreibt Dario zurück: Du meinst sicher Die Kontrakte des
Kaufmanns, von Jelinek, inszeniert von Nicolas Stemann, die du in
Hamburg gesehen hast, ich in Köln, und wo die Zuschauer auch über
Stunden berieselt wurden und immer mal wieder rein- und rausgehen
durften. Der Unterschied ist das Thema: Bei Jelinek/Stemann gings um
Ökonomie. Meine Antwort: Und genau darin,Dario Damiano, sehe ich keinen
Unterschied, sondern die wesentliche Verbindung. Zum Beispiel könnte man
mit Giorgio Agamben fragen:
Warum braucht die Macht die Herrlichkeit? Wenn sie wesentlich Stärke, Handlungs- und Regierungsfähigkeit ist, weshalb tritt sie dann in der »glorreichen«, das heißt strengen und schwerfälligen Form der Zeremonie, der Akklamation und des Protokolls auf? In welcher Beziehung stehen Ökonomie und Herrlichkeit?
Und wenn Agamben den logos, das Wort Gottes, als wesentlichen Teil
von Ökonomie sieht, also von Herrschaftspraxis, was würde Hamann zu
diesem logos-Begriff sagen? Bada bing bada boom, antwortet Damiano, mal
ehrlich, Jörg, gehts noch komplizierter?
– Na, immer doch.
– Ist ja wie ein Wettbewerb für Bilder, auf denen man den Abgebildeten nicht erkennen kann.